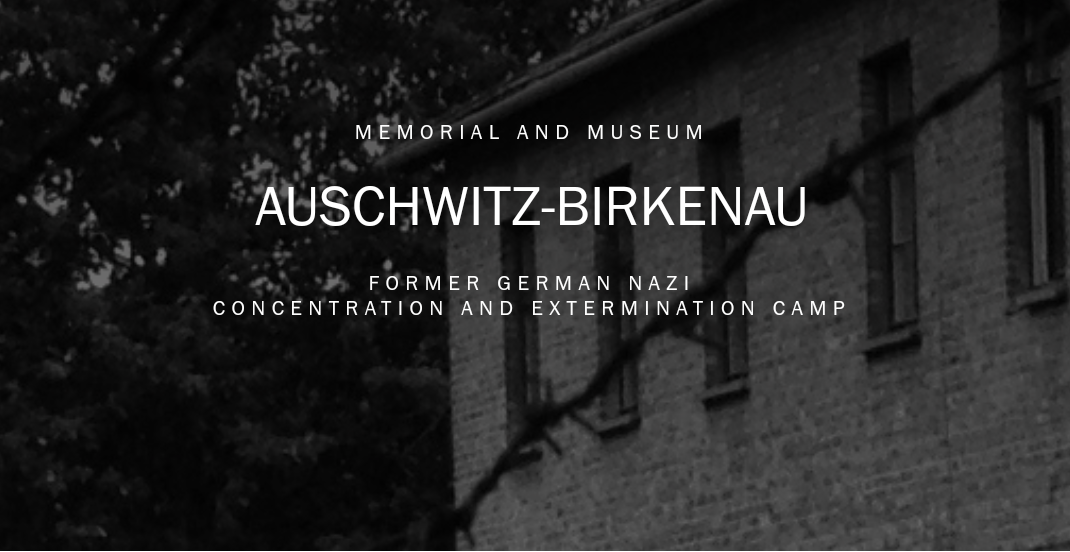Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

Als Gedenktag erinnert er jährlich an die tiefe Zäsur von 1945, den Neuanfang und die doppelte Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus. Doch das war nicht immer so. Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 hat bis heute große Bedeutung für die gesamtdeutsche Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges.
"Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft." So lautet die wohl am häufigsten zitierte Sentenz aus Weizsäckers Gedenkrede. Mit dieser Aussage hob sich der Bundespräsident deutlich vom Denken der Nachkriegszeit ab.
2077 Tage dauerte der Zweite Weltkrieg oder, noch genauer: 49.842 Stunden und 16 Minuten. Die Kampfhandlungen begannen, abgesehen von einzelnen Scharmützeln an der deutsch-polnischen Grenze, am 1. September 1939, als das alte Linienschiff „Schleswig-Holstein“ das Feuer auf die Westerplatte bei Danzig eröffnete, und endeten am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr. Durchschnittlich starben in jeder Stunde von Hitlers Krieg 1000 Menschen.
Rund jedes zehnte Opfer des Zweiten Weltkriegs war ein deutscher Soldat. Damit sind die Verluste der Wehrmacht deutlich geringer als etwa jene der Roten Armee. Dennoch waren die Verluste unermesslich: Von den Männern der Jahrgänge 1921 bis 1927 starben 31,6 Prozent, also fast jeder Dritte. Fast ebenso hohe Verluste, zwischen 27,1 und 29,6 Prozent, trafen die Jahrgänge zwischen 1906 und 1920. Hinzu kommen die körperlich und seelisch versehrten Soldaten. Sie alle waren Opfer von Hitlers Krieg.
20.000 Männer wurden zwischen 1939 und 1945 hingerichtet, weil Sie den Wehrdienst verweigerten. Einer von Ihnen war der Landwirt und Kraftfahrer Franz Jägerstätter. Bereits 1965 wurde seine Haltung und Opfer in einer Reportage des ARD-Magazin Panorama beleutet. Ein sehenswerter Beitrag von 15 Minuten mit einem spannenden Blick in Gesellschaft und Gesichter der Nachkriegszeit.

Eine filmreife Geschichte, die tatsächlich 2020 auf die Leinwand kam.
Ein verborgenes Leben - Homepage zum Film – Ab 30. Januar 2020 im Kino
Weitere Quellen:
"Wir […] müssen die Vergangenheit annehmen" | Deutschland Archiv | bpb.de
Zweiter Weltkrieg: Pro Stunde starben 100 deutsche Soldaten - WELT



 Du denkst und ich bin ...
Du denkst und ich bin ...